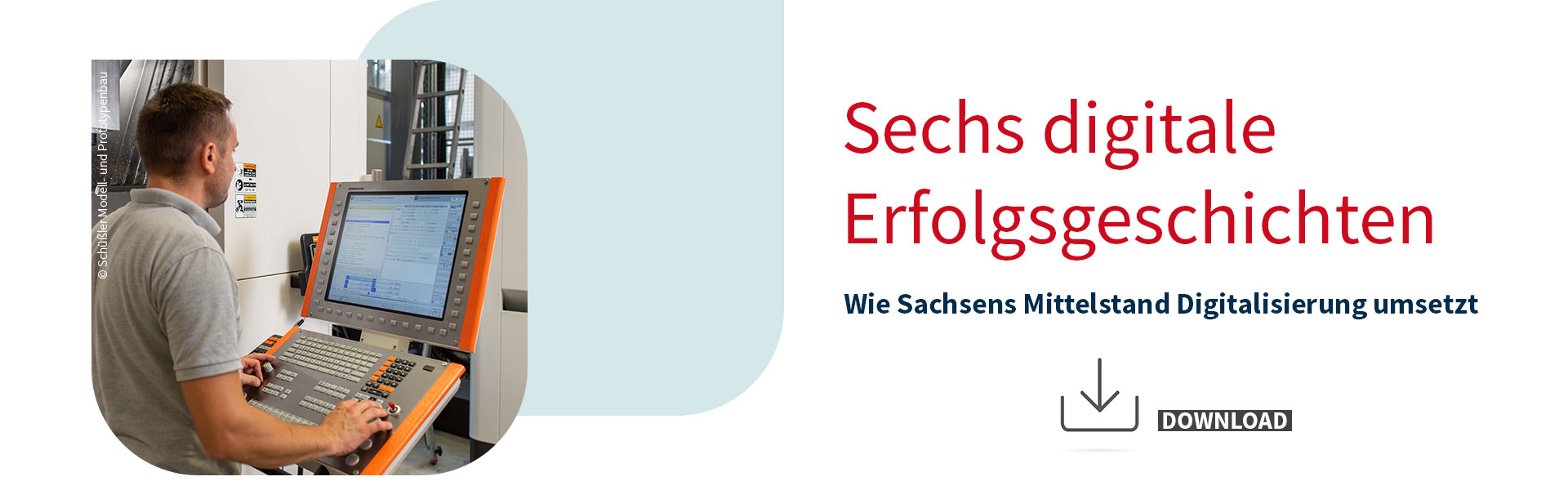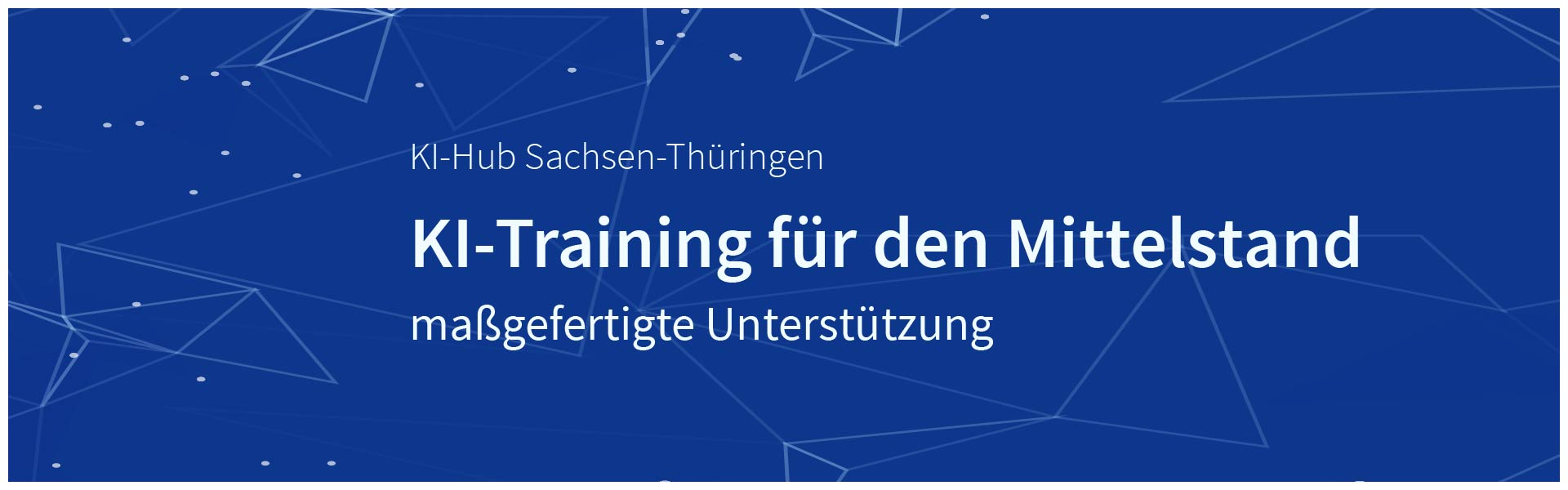KI-HUB SACHSEN-THÜRINGEN
Wir sind Mitbegründer des KI-Hub Sachsen-Thüringen und bieten für alle Fragen rund um das Thema Künstliche Intelligenz maßgeschneiderte Unterstützung. Beispielsweise setzen wir KI-Projekte mit Ihnen um, führen Qualifizierungen durch und geben Zugang zu Forschung und Entwicklung.
Profitieren Sie von individuellen KI-Trainings und von unserem Know-how durch die Zusammenarbeit mit anderen Zentren, mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die Angebote tragen dazu bei, neue Lösungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln und so Ihre Wettbewerbsposition zu verbessern. Nutzen Sie die Chancen von KI und nehmen Sie Kontakt mit dem KI-HUB Sachsen-Thüringen auf.